INHALT
- Allgemeines zur „Hysterie“ (Begriff, Implikationen und Besonderheiten)
- ICD-10 – Standortbestimmung
- Die Geschichte der hysterischen Symptomneurose
- Literaturverzeichnis
Allgemeines zur „Hysterie“ (Begriff, Implikationen und Besonderheiten)
Die „Hysterie“ oder das „Hysterische“ nimmt unter den Neurosen in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein:
1. An den Begriff knüpft sich seit seiner Prägung durch Hippokrates im Jahre ! eine jahrtausende lange Tradition, in der jedoch das, was man genau darunter verstehen wollte insbesondere seit T. Sydenham und der endgültigen Fixierung der Gebärmutter im Unterleib starken Veränderungen unterlag.
2. Die „Hysterie“ galt seit ihrer Beschreibung entsprechend der damaligen Ätiologie als fest mit dem weiblichen Geschlecht verbunden. Erst seit Charcot wurde die Vorstellung einer „männlichen Hysterie“ zunehmend salonfähig. Dennoch bleibt die Bezeichnung „hysterisch“ im Volksmund auch heute noch mit negativ empfundenen Vorstellungen vor allem über das weibliche Geschlecht verbunden und wirkt als Diagnose stigmatisierend.
3. Die „Hysterie“ ist die Modellneurose, anhand derer FREUD seine Psychoanalyse entwickelte.
4. Keine andere Neurose ist so schillernd, so schöpferisch und anpassungsfähig an epochale Besonderheiten und ärztliche oder therapeutische Vorstellungskraft und löst derart heftige angenehme oder auch unangenehme Gegenübertragungen aus.
5. In besonders hervorstechender Weise benötigt der „Hysterische“ zur Auslebung seiner Neurose Beziehungspartner, die in die Pathologie involviert sind und sie damit unterhalten. Die Hysterie ist also eine Art „Beziehungsmodus“, sie existiert nicht alleine.
ICD-10 – Standortbestimmung
Brigitte Boothe bezieht zu Beginn ihres Aufsatzes über männliche Hysterie 1996 Stellung zur neuen Klassifizierung ehemals hysterisch genannter Störungen in der ICD-10, in der u.a. mit dem Hinweis auf die negative Besetzung des Begriffes Hysterie dieser durch den Begriff „histrionisch“ ersetzt wurde. Boothe meint, daß „die Meidung des Ausdrucks „hysterisch“ (Anm.: und dessen Ersetzung durch „histrionisch“) unter dem Aspekt der Menschenfreundlichkeit nicht besonders gelungen“ erscheint. Vielmehr viele die Beschreibung des klinischen Bildes „nicht respektabler aus als in früheren Zeiten. Im Gegenteil, die nackte und kahle Konstatierung manifester Merkmalskonfigurationen läßt den Eindruck verfehlter Lebensertüchtigung, gemessen an einer impliziten Norm sozialer Effizienz und erfolgreicher Resourcenverwertung, entstehen.“ Ihr Urteil: „Die Bemühung um milde Schonung dient eher der Infantilisierung als der Würdigung. Kritische Wertung im Bereich psychodiagnostischer Beschreibung sollte in guter psychoanalytischer Tradition als Bestandteil fruchtbarer Auseinandersetzung mit der Person gesehen werden. Sie darf nicht als Festschreibung oder Verurteilung wirken. Sie markiert einen immer nur vorläufigen Standpunkt im unabschließbaren Spiel von Annäherung und Distanz in der Beziehung.“
Die Geschichte der hysterischen Symptomneurose
Von der Antike bis ins 17. Jahrhundert
Die ältesten Beschreibungen von Erkrankungen, die wir heute als eindeutige hysterische Störungen bezeichnen würden finden sich in den altägyptischen Fragmenten des Kahun-Papyrus aus der Zeit um 1900 vor Chr unter einem Kapitel über Erkrankungen des Uterus. Die Ursache dieser Störungen wurde damals in einer Veränderung der Position der Gebärmutter gesehen, welche, durch sexuelle Abstinenz hungrig geworden, auf der Suche nach Befriedigung die Reise durch den Körper antrat und auf ihrem Weg andere Organe in Unordnung brachte. Dieses pathogenetische Konzept wurde unverändert in die griechische Medizin überliefert und man findet bei Hippokrates (460 – 377 v. Chr.) in seiner Abhandlung „Über die Erkrankungen der Frauen“ beinahe identische Formulierungen wie in dem besagten Papyrus. Hippokrates führt für diese an Wanderungen der Gebärmutter gebundene Störungen erstmals den Begriff „Hysterie“ (von hystera = griech.: Gebärmutter) ein. Es ist auffällig, daß schon damals die „Hysterie“ mit dem weiblichen Geschlecht und vor allem mit sexueller Frustration und unerfülltem Kinderwunsch assoziiert war.
Im „Timaios“ von Plato (427 – 347 v. Chr.) heißt es: „Die Gebärmutter ist ein Tier, das glühend nach Kindern verlangt. Bleibt dasselbe nach der Pubertät lange Zeit unfruchtbar, so erzürnt es sich, durchzieht den ganzen Körper, verstopft die Luftwege, hemmt die Atmung und drängt auf diese Weise den Körper in die größten Gefahren und erzeugt allerlei Krankheiten“
Galenus (129 – ca 200 n. Chr.) „hat als erster schriftlich die Doktrin von der freien Mobilität des Uterus verworfen. Damit ist die Krankheit Hysterie schon früh in ihrem Fundament, der supponierten Ätiologie, erschüttert worden.“ Auch für ihn ist jedoch die Enthaltsamkeit, die Retention weiblichen Samens der ätiologische Faktor hysterischer Störungen.
Das Mittelalter sah in der „Hysterie“ vor allem Besessenheit, die Symptome wurden als „stigmata diaboli“ bezeichnet und entstanden durch Berührungen des Teufels. „Im Rahmen der Inquisition kam es dann zu den Hexenverfolgungen. Interessant ist hier der Wechsel vom individuellen Ausdruck der Hysterie zur Massenhysterie, Ansteckung, Nachahmung und Identifizierung…In dem Maße, in dem sich die Hysterie in religiöse Bereiche, vor allem in deren profanere, nichtsdestoweniger aber sehr anregende Varianten zurückzog, entmedikalisierte sie sich.“
Die Rückkehr der Hysterie zur Medizin erfolgt mit Paracelsus (1493 – 1541). Diese Wiedereingliederung konsolidiert sich erst im 17. Jahrhundert durch den Gehirnanatomen Willis, der der Hysterie zwar einen viszeralen Ursprung beläßt, dem Gehirn jedoch eine Relaisfunktion zuspricht. Auch der Landsmann und berühmte Zeitgenosse Thomas Sydenham sah in der Hysterie eine Krankheit. Er siedelte sie nahe der Hypochondrie an. Die Begriffe wurden denn auch längere Zeit synonym gebraucht, eine nervöse Ätiologie wurde vermutet. Trotzdem blieb in den Köpfen ein gewisser Unterschied bestehen. „Symptomatologisch standen bei der Hypochondrie die gastrointestinalen Symptome und die Erschöpfung, bei der Hysterie die Krämpfe mehr im Mittelpunkt.
„Der Franzose Lepois (1618) stellte Hysterien erstmals auch bei Männern und Kindern fest, was jedoch kaum beachtet wurde.“
„Hysterie“ im 18. und 19. Jahrhundert
m Laufe des 18. Jahrhunderts begann sich dann zwischen Hypochondrie und Hysterie ein neurer Unterschied auszubilden. Während nämlich die Hypochondrie…mehr und mehr sich zum Zustandsbild entwickelte, blieb die Hysterie eine Krankheit. Man kann etwas überspitzt sogar sagen, die Hysterie sei um so mehr Krankheit geworden, je mehr die Hypochondrie Zustandsbild geworden sei, bis sie diese endlich in ihrer Krankheitsfunktion habe ersetzen helfen.
Cullen ( Anm.: Wiiliam C. (1710 – 1790)) dann zählt Hypochondrie wie Hysterie zu den „Neuroses“ ( ), die Hysterie aber zu den „krampfartigen Krankheiten“, während die Hypochondrie eine Entkräftung sei (ein Punkt übrigens auf der Entwicklungslinie von der Hypochondrie zur Neurasthenie).
Im 19. Jahrhundert kommt der Uterus zu neuen Würden. Philippe Pinel (1745 – 1826) glaubt, Hysterie sei eine Genitalneurose der Frau, auch Villermay (1776 – 1837) ist dieser Ansicht.
Griesinger ( 1817 – 1868) schreibt in der zweiten Auflage seines Werkes „Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten (1861): „Das Licht, das durch das Speculum fällt, wird, wie es die Hysterie so wohl beleuchtet, auch vieles der Hysterie nahestehendes Irresein allein zu erhellen vermögen!“ Ein weiterer berühmter Vertreter der Uterustheorie-Renaissance ist z.B. Landouzy.
„Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts verlor sich die Uterogenese der Hysterie wieder, die Hysterie wurde ein allgemeines Nervenleiden wie die übrigen Hypochondrieerben – sie blieb jedoch mehr oder weniger ein Frauenleiden.“
Wegen der häufigen Konzeptveränderungen und der fehlenden ätiologischen Klarheit wurde bereits damals vor einem Mißbrauch des Begriffes Hysterie gewarnt, z.B. von Kraepelin, der 1889 bei der Hysterie nichts scharf Definierendes findet außer „vielleicht die außerordentliche Leichtigkeit und Schnelligkeit…, mit welcher sich psychische Zustände in mannigfaltigen körperlichen Reaktionen wirksam zeigen oder von Lasègue, der die Hysterie einen Papierkorb nennt, in den die Mediziner die Symptome wärfen, die sie nicht anders einordnen könnten . Für ihn ist Hysterie gleichbedeutend mit Nosophobie.
Franz Anton Mesmer und der tierische Magnetismus
Parallel zu den oben beschriebenen Vorgängen gab es Ende des 18. Jahrhunderts mit der Entdeckung des „tierischen Magnetismus“ durch den Arzt Franz Anton Mesmer (1734 – 1815) eine neue Art in der Behandlung von Menschen mit unterschiedlichsten Körperstörungen, die den Grundstein zu einer „Dynamischen Psychologie“ und später auch „Psychotherapie“ legte. Durch den Magnetismus (Mesmerismus) wurde ab 1775 der damals übliche Exorzismus, wie er z.B. noch von dem berühmten Pater Gassner (1727 – 1779) in Ellwangen betrieben wurde schrittweise abgelöst.
Gassner „unterschied zwei Arten von Krankheiten: natürliche, die in den Bereich des Arzte gehören, und übernatürliche, die er in drei Kategorien einteilte:
circumsessio (die vom Teufel hervorgerufene Nachahmung einer natürlichen Krankheit)
obsessio (die Wirkung von Hexerei) und
possessio – die seltenste der drei Arten – (offenkundige Teufelsbesessenheit)
In allen diesen Fällen sagte Gassner dem Patienten zunächst, der Glaube an den Namen Jesu sei eine notwendige Voraussetzung für die Heilung, dann bat er um seine Einwilligung zu einem exorcismus probativus (Probe-Exorzismus). Darauf beschwor er den Dämon feierlich, die Krankheitssymptome hervorzubringen; wenn die Symptome erschienen, hielt Gassner es für bewiesen, daß die Krankheit vom Teufel verursacht worden war, und er machte sich daran, ihn auszutreiben. Wenn sich aber keine Symptome zeigten, schickte er den Patienten zum Arzt.“ Aus vielen Krankenberichte wird deutlich, daß es sich bei den „übernatürlichen Krankheiten“ in der Regel um dissoziative Störungen handelte.
Im Zuge „der „Aufklärung“, die den Primat der Vernunft über Unwissenheit, Aberglauben und blinde Tradition verkündete“ – „die berüchtigten Hexenverfolgungen und -prozesse waren noch nicht ganz verschwunden (…), aber man mied alles, was an Dämonen, Besessenheit und Exorzismus gemahnte“ – verlor Gassner im Jahre 1775 zunehmend an Einfluß und wurde von mehreren hoheitlichen Untersuchungskommissionen begutachtet.
In einer dieser Kommissionen im Auftrag des Kurfürsten Max Joseph v. Bayern befand sich Dr. Mesmer, der nach dem oben erwähnten Prinzip des „tierischen Magnetismus“ bereits seit einiger Zeit Demonstrationen an vielen Orten in Deutschland durchführte, bei denen er durch leichte Berührungen das Auftreten und Verschwinden verschiedener Symptome, sogar von Krämpfen hervorrief. Dadurch, daß er Arzt war, paßte Mesmer besser in das neue Bild einer aufgeklärten Ära und gewann zunächst große Berühmtheit. Er wirkte vor allem am Bodensee, aber auch in Wien und in Paris. Später führte er auch kollektive Behandlungen durch, die er „baquet“ nannte.
Mesmers System läßt sich nach Ellenberger (S. 102) in vier Grundprinzipien zusammenfassen:
(1) Ein subtiles physikalisches Fluidum erfüllt das Universum und stellt eine Verbindung zwischen den Menschen, der Erde und den Himmelskörpern her, ebenso zwischen den einzelnen Menschen.
(2) Krankheiten entstehen aus der ungleichen Verteilung dieses Fluidums im menschlichen Körper; die Genesung wird erreicht, sobald das Gleichgewicht wiederhergestellt ist.
(3) Mit Hilfe bestimmter Techniken läßt sich dieses Fluidum kanalisieren, aufbewahren und anderen Personen übermitteln.
(4) Auf diese Weise lassen sich bei Patienten „Krisen“ hervorrufen und Krankheiten heilen.
Entsprechend diesem System äußerte er den berühmten Ausspruch: „Es gibt nur eine Krankheit und eine Heilung.“ Kein Medikament und kein therapeutisches Verfahren heilten nach Mesmer für sich allein; Heilung komme nur durch die Wirkung des Magnetismus zustande, obwohl die Ärzte sich dessen nicht bewußt seien. Der tierische Magnetismus werde der Menschheit nun ein Universalmittel an die Hand geben, mit dem man jede Art von Krankheit heilen und verhindern und so „die Medizin zu höchster Vollkommenheit bringen“ könne.
Mesmer war sehr erfolgreich, die Heilungen immer aufwendiger und spektakulärer, von den Patienten bezog er fürstliche Honorare. Da er zudem despotisch und wohl auch arrogant, egozentrisch, mißtrauisch, launisch, gierig und unehrlich war, weckte er in der Ärzteschaft sowohl Neid als auch Ärger und wurde schließlich zunehmend unbeliebt. Es wurde kritisiert, daß Mesmer angab ein neues physikalisches Fluidum entdeckt zu haben, und es wurde auf die Gefahr hingewiesen, die entsteht, wenn ein Hypnotiseur derartige Macht z.B. auf weibliche Patientinnen nehmen köne. Auch aus den Reihen seiner Anhänger und Schüler kam zunehmend Kritik.
Trotzdem wurde in Paris die „Société de l’Harmonie“ gegründet, nach Ellenberger „eine seltsame Mischung aus Geschäftsunternehmung, privater Schule und Freimaurerloge“ mit Zweigstellen in vielen französischen Groß- und Kleinstädten. Da der Magnetismus in Frankreich bereits fest verankert war, gedieh das Unternehmen gut und warf reiche Gewinne ab. Mesmer selber allerdings verlor immer mehr an Bedeutung und geriet schließlich in Vergessenheit. Ohne öffentliche Notiz kehrte er ein oder zwei Jahre vor seinem Tod 1815 nach Meersburg zurück.
Bernheim und die Schule von Nancy
Zwischen 1860 und 1880 war es für Ärzte nicht günstig, sich mit Magnetismus und Hypnose zu beschäftigen, da sie dann ihre wissenschaftliche Karriere aufs Spiel gesetzt hätten. Beide Methoden waren zu diesem Zeitpunkt zu sehr unter Verruf gekommen.
Dennoch gab es Wenige, die unverhohlen hypnotisierten, z.B. der Arzt Auguste Ambroise Liébeault (1823 – 1904), der geistige Gründer der sog. Schule von Nancy. Er heilte in hypnotischen Schlafzuständen, hatte damit viel Erfolg, galt jedoch über 20 Jahre lang als Quacksalber und Narr. (Als Narr v. a. deswegen, weil er ohne Honorar arbeitete.) Von seinen Wundertaten angezogen besuchte ihn 1882 Hippolyte Bernheim (1840 – 1919), bis 1871 Professor für Innere Medizin an der Universität Straßburg, anschließend in Nancy. Durch Liébeault inspiriert begann er anschließend, die Hypnosemethode an seiner Universität einzusetzen. Durch ihn und seine Bemühungen, die Welt vom Werk Liébeaults in Kenntnis zu setzen kam jener sehr verspätet doch noch zu großem Ruhm. 1886 veröffentlichte Bernheim sein Lehrbuch, welches ein großer Erfolg wurde und ihn zum Führer der Schule von Nancy machte. Diese bestand im wesentlichen aus vier Männern: Liébeault, Bernheim, dem Gerichtsmediziner Beaunis und dem Rechtsanwalt Liégeois. Dazu kam ein lockerer Kreis von Anwendern der Methode, u.a. Krafft-Ebing in Österreich, van Eeden in Holland, Auguste Forel in der Schweiz und Bechterew in Rußland. Auch Sigmund Freud reiste 1889 zu Bernheim nach Nancy.
Bernheim wandte im Laufe der Zeit immer weniger die Hypnose zur Heilung an, sondern verwendete die Suggestion im Wachzustand. Dieses neue Verfahren wurde in der Schule von Nancy als „Psychotherapeutik“ bezeichnet.
Um 1900 wurde Bernheim von vielen Menschen als der hervorragendste Psychotherapeut Europas angesehen. Leider hielt dieser Ruhm nicht an, bereits nach 10 Jahren war er beinahe vergessen und Andere hatten seine Methoden annektiert.
Charcot an der Salpêtrière in Paris
Es gibt ein berühmtes Gemälde einer Photographie von André Brouillet, das eine Frau namens Blanche Wittmann beim Endstadium eines hysterischen Anfalls unter Hypnose darstellt. Die Dame galt an der Salpêtrière in Paris als „Königin der Hysterikerinnen“ und war eines der begehrten Schauobjekte, die Charcot in seinen spektakulären Dienstagsvorlesungen (leçons du mardi) der begeisterten Menge vorführte. Unter Hypnose konnte er die unterschiedlichsten hysterischen Körperphänomene bis hin zum großen hysterischen Anfall sozusagen auf Kommando hervorrufen und auch wieder zum Verschwinden bringen.
J.M.Charcot (1870 – 1893)
Charcot galt als größter Neurologe seiner Zeit, als „Napoleon der Neurosen“ und genoß internationales Ansehen. Seit 1856 war er Stationsarzt an der bekannten Pariser „Salpêtrière“ . Nach einer langen und schwierigen ärztlichen Laufbahn wurde er 1862 Chefarzt einer großen Abteilung der Anstalt und begann, ein neurologisches Forschungszentrum einzurichten mit exakten klinischen Untersuchungen und Falldemonstrationen. Zur Durchführung sammelte er eine Reihe begabter Schüler um sich.Es folgten zwischen 1862 und 1870 wichtige Entdeckungen auf dem Gebiet der ALS, Muskelatrophien, der Tabes und der MS. 1872 wurde Charcot Professor für pathologische Anatomie, 1882 wurde ihm der erste Lehrstuhl für Neurologie eingerichtet.
1870 übernahm er eine spezielle Abteilung mit „Krampfkranken“ und wandte sein wissenschaftliches Interesse daher der Differentialdiagnose der epileptischen und hysterischen Krämpfe und damit der Erforschung der rätselhaften „Hysterie“ zu. Er trat entschieden für die Echtheit hysterischer Symptome ein und milderte damit das Stigma. Nach seiner Auffassung waren die beobachteten Phänomene nicht simuliert, sondern Ausdruck einer echten Erkrankung. Er war beeindruckt von den hysterischen Phänomenen wie Anästhesien, Störungen des Sehsinnes, der Existenz hysterogener Punkte, insbesondere aber vom Charakter des großen hysterischen Anfalls, welchen er zum Vollbild der Hysterie zählte. Durch die „exakte“ Untersuchung dieser Krankheitszeichen versuchte er, die Hysterie positiv zu definieren und wählte daher vorwiegend Patienten zum Forschungsobjekt, die den großen Anfall hervorbrachten. Durch die „Vorstellung“ solcher Patienten in den öffentlichen Dienstagsvorlesungen erregte er selbstverständlich großes Aufsehen, die Darstellungen sollten auch dazu dienen, die Zuschauer von der Echtheit der Erkrankung zu überzeugen. Später wurden ihm u.a. von Janet und Freud methodische Fehler bei der Auswahl der Untersuchungsobjekte vorgeworfen.
Der große Anfall lief nach Charcot in den folgenden vier Phasen gesetzmäßig ab (zitiert nach Gödde, S. 19):
– beginnend mit Muskelzuckungen, die dem epileptischen Anfall ähnlich sind, über
– die zweite, „Clownismus“ genannte Phase der „großen Bewegungen“ , deren typischste der hysterische Bogen („arc de cercle“) ist, bei dem der rückwärts gewandte Körper nur am Kopf und an den Füßen aufs Bett gestützt wird,
– die dritte Phase der „leidenschaftlichen Stellungen und Gebärden“, in welcher der Kranke sozusagen seinen Wahn in Szene setzt, wobei er Worte und Schreie ausstößt, die in Beziehung zu seinen düsteren Vorstellungen und ihn verfolgenden Schreckensvisionen stehen,
– zum abschließenden Wahnstadium (Delirium), in dem der Kranke, nachdem sein akuter Erregungszustand abgeklungen ist, am ehesten dazu bewegt werden kann, seine oft sehr intimen Wahnvorstellungen auszusprechen.
Bei der Untersuchung von funktionellen Lähmungen nach Eisenbahnunfällen (1884/85) fiel Charcot die Ähnlichkeit mit den bekannten hysterischen Phänomenen auf und er gruppierte die posttraumatischen Lähmungen fortan unter die Hysterie. Bestätigt sah er sich in dieser Auffassung durch die Tatsache, daß er die Lähmungen ebenso wie die Bewegungsstörungen Hysterischer durch Hypnose sowohl hervorbringen als auch wieder zum Verschwinden bringen konnte. Im Zuge dieser Entdeckung prägte er auch den Begriff der männlichen Hysterie.
Die Untersuchungen Hysterischer führten Charcot zu den Annahme, daß es sich bei der hysterischen Symptombildung um eine quasi-neurologische Gesetzmäßigkeit handele, daß die „Hysterie“ eine funktionelle Nervenkrankheit sei, die bei bestehender erblicher Disposition als Grundursache unter Hypnose oder nach Auftreten sogenannter Gelegenheitsursachen („agents provocateurs“) im Normalzustand die eigentümlichen Symptome des großen Anfalls, der Hemianästhesien, der hysterogenen Zonen, der Seh- und Bewegungsstörungen hervorbrächten.
Nicht nur die Hysterie untersuchte Charcot, sondern auch die von ihm verwendete Methode zur Auslösung der hysterischen Phänomene, die „Hypnose“.
Er „erkannte“ drei (gesetzmäßig) aufeinanderfolgende Stadien der Hypnose:
1. die Lethargie (Schlaffheit)
2. die Katalepsie (Gliederstarre)
3. den Somnambulismus (Schlafzustand)
Diese Stadien waren für Charcot Ausdruck spezifischer physiologischer Veränderungen, wie sie seiner Meinung nach nur bei Hysterischen vorkämen. Das Auslösen hypnotischer Zustände war für ihn also untrennbar mit der Diagnose Hysterie verbunden, ein Hauptwesenszug der Erkrankung daher die Suggestibilität!
Nachdem er diese Erkenntnisse 1882 der „Académie des Sciences“ vortrug, „erreichte er, daß die Hypnose, welche schon dreimal, 1784, 1831 und 1840 von derselben Akademie als unwissenschaftlich verurteilt worden war und noch immer als unseriös galt, rehabilitiert wurde.“ In der Folge begann auf dem Gebiet der Hypnose ein immense Forschungstätigkeit.
Nach dem Vortrag Charcots entbrannte ein dauerhafter heftiger Streit zwischen der Lehre der Salpêtrière und der Schule von Nancy, da Bernheims Auffassung über Hypnose eine gänzlich andere war. Im Gegensatz zu Charcot war er überzeugt, daß die hypnotischen Phänomene auf Suggestion beruhten und daher nicht nur bei Hysterischen anzutreffen seien.
Entgegen der überlieferten Auffassung schrieb Charcot der sexuellen Genese der Hysterie keine Bedeutung mehr zu. Darin berief er sich auf die große Abhandlung Briquets aus dem Jahre 1859, die die erste wirkliche wissenschaftliche Untersuchung der Erkrankung durchgeführt hatte.
Es gab zu dieser Zeit viele Veröffentlichungen über Hysterie. Auch das Thema Hypnose wurde breit und kontrovers diskutiert. Ebenfalls im Aufschwung war die Beschäftigung mit Sexualität und die Entwicklung einer Sexualpathologie, nicht nur in Frankreich (z.B. Krafft-Ebing)
Die Darstellung der wesentlichen Arbeten würde den Rahmen dieses Referates sprengen, es soll jedoch das berühmte Werk von Charcots Schüler Gilles de la Tourette über die Hysterie zur zusammenfassenden Darstellung der Hysterielehre Charcots verwendet werden. Nach Gödde (1994) lassen sich folgende Elemente der Charcotschen Hysterielehre skizzieren:
A. Historisches Anfangskapitel:
1. Abgrenzung von den mythologischen und vorwissenschaftlichen Auffassungen von der Gebärmutter als gefräßiges Tier und Sitz der Erkrankung
2. Abgrenzung von der Vorstellung, Hysterie gäbe es nur bei Frauen, nicht aber bei Kindern und Männern
3. Abgrenzung von der Vorstellung, hysterische Phänomene seinen das Werk von Dämonen und Teufeln
B. Zwei ätiologische Kapitel:
1. Die Hysterie gehört zur „famille névropathique“, Grundursache sei also die Vererbung
2. Daneben gibt es „Gelegenheitsursachen“ („agents provocateurs“), z.B. lebhafte Gemütszustände, suggestive, hypnotische und negative erzieherische Einflüsse, die die Disposition zur Auslösung bringen können.
3. Bei den posttraumatischen Lähmungen nach Eisenbahnunglücken handele es sich nicht um organische sondern um hysterische Lähmungen.
4. Die Hypnose ist ein der Hysterie sehr nahestehender Krankheitszustand, der auch nur bei Hysterischen vorkomme
5. Die Sexualität spielt in der Ätiologie der Hysterie keine entscheidende Rolle. Die beobachteten erotischen Halluzinationen seien nur auf psychische Wunschvorstellungen, nicht aber auf geschlechtliche Begierden zurückzuführen.
C. Sieben symptomatologische Kapitel, Hauptteil der Arbeit, mit Einteilung der Phänomene in drei große Gruppen:
1. Sensibilitätsstörungen:
– Anästhesien und Hyperästhesien der Haut, Schleimhäute und Sinnesorgane
– Störungen der Geschmacks- und Geruchsempfindungen, Des Gehörs bis
hin zur hysterischen Taubheit, des Kehlkopfes, der Stimmbänder sowie der
sexuellen Empfindungslosigkeit
– Auftreten von Hyperästhesien und Anästhesien an den gleichen Körperstellen
– „hysterogene Zonen“ (z.B. die Ovarialgegend, aber auch beliebige andere Stellen)
2. Störungen im Bereich des Sehapparates:
– Amblyopie mit konzetrischer Gesichtsfeldeinengung
– vorübergehende Blindheit
– Affektionen der Augenmuskeln
3. Neigung zu Muskelkontrakturen, Muskelschwäche (Amyostenie) und Muskelzittern
(Tremor)
D. Kapitel über die psychischen Phänomene der Hysterie:
1. Widerlegung der Auffassung, Hysterie beruhe auf Lüge oder Simulation:
– der Hysterische sei „passiv, „eine Art photographischer Platte“, die bestimmte
Eindrücke nur so wiedergeben kann, wie sie sie empfangen hat, „für langdauernde
Kombinationen nicht zu gebrauchen“, ein „Sklave der Eingebung des Augenblicks“,
eine „Form, in die sich unbewußt die Suggestion einprägt“ (S. 307, zit. nach Gödde,
S. 27)
– Hysterische seien nicht fähig, sich selber zu steuern. Sie seien im Wesen suggestibel,
stark beeinflußbar, leichtgläubig wie Kinder, hochgradig empfänglich für traumatische
Suggestionen und zeigten übermäßige Emotionalisierung
„Kurz, die große Vorliebe der Hysterischen für die Lüge ist eine Legende ohne ernste
Grundlage, gegen die sowohl der gesunde Verstand wie die klinische Beobachtung
sprechen. Die Hysterischen haben sehr oft einen unbeständigen, phantastischen und
romantischen Charakter; sie überlassen sich ohne Überlegung den Regungen des
Augenblicks, und ihre Zärtlichkeit wie ihr Haß ist oft gleich wenig berechtigt, aber sie
sind nicht die verhärteten Lügner, die man aus ihnen machen will.“ (S. 316)
Kritik an Charcot:
Charcots Ausführungen blieben nicht unkritisiert. Insbesondere sein Schüler Janet, aber Auch Freud waren unter den Kritikern.
Janet warf ihm folgende methodische Fehler vor :
1. sein übersteigertes Bestreben, spezifische Krankheitseinheiten zu beschreiben, wobe er als typische Beispiele die Fälle auswählte, die möglichst viele Symptome auswiesen; er nahm an, die anderen Fälle seien unvollständige Formen.
2. die übermäßige Vereinfachung in den Beschreibungen dieser komplexen Krankheitsbilder, um sie Studenten leichter verständlich zu machen.
3. das mangelnde Interesse Charcots an der Vorgeschichte seiner Patientinnen und für die Lebensumstände auf den Stationen der Salpêtrière. So entging ihm, daß seine Patienten oft von inkompetenten Leuten besucht und magnetisiert wurden, daß ihnen die „drei Hypnosestadien“ regelrecht antrainiert wurden. „Wegen der paternalistischen Haltung Charcots und der despotischen Art, wie er seine Studenten behandelte, wagte seine Mitarbeiter nie, ihm zu widersprechen; sie zeigten ihm deshalb, was er nach ihrer Meinung sehen wollte. Nachdem sie die Demonstrationen ingeübt hatten, führten sie die betreffenden Personen Charcot vor, der so unvorsichtig war, die Fälle in Anwesenheit der Patienten zu besprechen. Eine höchst eigenartigeAtmsphäre der psychischen Suggestion entwickelte zwischen Charcot, seinen Mitarbeitern und seinen Patienten“
Bernheim teilte diese Kritik und glaubte, daß Charcots Entdeckungen des „Grand hypotisme“ und der Grande Hystérie“ bloße Kunstprodukte seien und brachte in einem 1891 in „Le Temps“ veröffentlichten Aufsatz das Beispiel einer Patientin, die als ehemalige Kranke der Salpêtrière einem speziellen Training unterworfen worden sei, bevor sie Charcot dann die hypnotischen Stadien vorgeführt habe. Das war natürlich eine Breitseite gegen die Hysterielehre Charcots.
Freud griff 1888 diese Auffassung Bernheims auf und konstatierte: „Hat die Suggestion des Arztes die Phänomene der hysterischen Hypnose gefälscht, so ist es auch leicht möglich, daß sie sich in die Beobachtung der übrigen hysterischen Symptomatologie eingemengt hat, daß sie für die hysterischen Anfälle, Lähmungen, Kontrakturen usw. Gesetze aufgestellt hat, welche nur durch die Suggestion mit der Neurose zusammenhängen und daher ihre Gültigkeit verlieren, sobald ein anderer Arzt an einem anderen Orte hysterische Kranke beobachtet.“
Pierre Janet (1859 – 1947)
Janet nahm 1889 erst sein Medizinstudium auf, nachdem er sich lange Jahre bereits mit philosophischen und psychologischen Fragen beschäftigt hatte. Er unverzüglich mit psychologischen Forschungen an der Salpêtrière, unter anderem an Patienten von Charcot. Dabei arbeitete er völlig unabhängig von den Neurologen und hielt Vorlesungen über hysterische Amnesie und Anästhesie. Anhand seiner Patienten, unter anderem den berühmten Fällen „Marcelle“, „Lucie“, „Marie“ und „Madame D.“ entwickelte er seine Theorie der „psychologischen Analyse“ und der auf sie folgenden psychologischen Synthese. Die Hauptbefunde auf dem Wege zur Entwicklung der „psychologischen Analyse“ seien hier nach Ellenberger kurz dargestellt:
1. Entdeckung der „unterbewußten fixen Ideen“ und ihrer krankmachenden Funktion. Ihre Ursache war gewöhnlich ein traumatisches oder erschreckendes Ereignis, welches „unterbewußt“ geworden und durch Symptome ersetzt worden war.
2. Er fand Zwischenstufen „unbewußter“ Gedanken, zwischen klarem Bewußtsein und der konstitutionellen Mitgift der Patienten. Im Umkreis primärer fixer Ideen gab es häufig sekundäre fixe Ideen, die mit ersteren entweder durch Assoziation verbunden waren oder dieselben ersetzten.
3. „Unterbewußte“ fixe Ideen sind nach Janet zugleich Ursache und Folge von Geistesschwäche. Dadurch entsteht ein pathologischer Teufelskreis.
4. Der gelegentliche Symbolcharakter hysterischer Symptome wird geäußert.
Zur Reduktion von Widerständen gegen die Aufdeckung fixer Ideen wurde neben der Hypnose auch das „automatische Schreiben“ bzw. das „automatische Sprechen“ verwendet.
5. „Unterbewußte“ fixe Ideen sind ein charakteristisches Merkmal der Hysterie, im Gegensatz dazu sind sie bei der Zwangsneurose bewußt.
6. Die Therapie zielte auf die „unterbewußten“ fixen Ideen, wobei ein bloßes Bewußtmachen zur Heilung nicht ausreiche. Stattdessen müsse man de fixe Idee durch Auflösung oder Umwandlung zerstören.
7. Sehr wichtig ist der „Rapport“ im therapeutischen Prozeß.
Janet begann seine psychiatrischen Studien mit hysterischen Patienten, später wandte er sich aber auch anderen Neurotikern zu. Seine im Laufe der Zeit entstehende synthetische Neurosentheorie stellte er in zwei umfangreichen Büchern vor .
„Janet hat die theoretische Arbeit nie von der klinischen Beobachtung getrennt, und darum behalten Janets Fallgeschichten, wie sich auch die Neurosetheorie verändern mag, ihren Wert in bezug auf die Beschreibung der Symptome.“
„Janets Forschung über Hysterie wurde von 1886 bis 1893 in einer Reihe von Abhandlungen veröffentlicht und 1893 in seiner medizinischen Doktorarbeit zusammengestellt….Die Quintessenz des Janetschen Hysteriekonzepts ist die Unterscheidung zwischen zwei Ebenen von Symptomen: den „zufäligen“ (unwesentlichen oder von bestimmten Bedingungen abhängigen Symptomen) und den „Stigmata“ (dauernden, fundamentalen Symptomen). Die „Zufallssymptome“ sind abhängig vom Vorhandensein „unterbewußter“ fixer Ideen, von denen der Patient nichts weiß. Die „Stigmata“, von Janet auch als negative Symptome bezeichnet, sind Ausdruck einer grundlegenden Störung, die Janet „die Einengung des Bewußtseinsfeldes“ nennt.“
In seiner Abhandlung „L’automatisme psychologique“ (1889) versuchte Janet die hysterischen (Konversions-) Symptome seiner Patienten mit dem Begriff der „Dissoziation“ (franz.: désagrégation) zu erklären. Zu kurzen Ausführung des zugrundeliegenden Konzeptes zitiere ich Annegret Eckhardt (1996):
„Nach Janet’s Auffassung ist jeder Mensch konstitutionell mit einer gewissen Menge „nervöser“ psychischer Energie ausgestattet, die alle mentalen Prozesse zusammenhält und steuert. Ein Defizit solcher Energie („la misère psychologique“) könnte zu einer Auflockerung der normalen Integration der Persönlichkeit führen; die Koordination mentaler Funktionen – Erinnerungen, Wahrnehmungen, Willensakte, etc. – innerhalb einer einheitlichen psychischen Struktur unter der Kontrolle des Selbst oder des Ich ist dann nicht mehr gegeben. Nach Janet’s Auffassung lag die Ursache einer solchen Störung entweder in einem angeborenen Defizit dieser Energie oder in einem, durch ein psychisches Trauma bedingten, übermäßgen emotionalen Verbrauch dieser Energie. Eine solche „Dissoziation“ von Erinnerungen oder anderen Funktionen führt dann zu den entsprechenden dissoziativen Symptomen. Die „Anfälligkeit zur Hypnose“ bzw. das Ausmaß der Hypnotisierbarkeit eines Menschen sah er als Resultat eines solchen Defektes an (…). Für Janet – ebenso wie für viele spätere Autoren (…) – waren die Hysterie und die Hypnose eng verbunden; für beide Phänomene machte er ursächlich die Dissoziation verantwortlich. Janet verstand die Hysterie aber dennoch als eine, im wesentlichen genetisch bedingte Erkrankung („pathologische Erblichkeit“).“
Eine große Arbeit über Hysterie veröffentlichte Janet 1892. Sie wurde zwei Jahre später unter dem Titel „Der Geisteszustand der Hysterischen“ ins Deutsche übersetzt. Hierin führte er anhand zahlreicher psychologischer Fallstudien eine Analyse der für die Hysterie maßgeblichen psychischen Störungen, nämlich Anästhesien, Amnesien, Abulien (Verminderung der Willenskraft), Bewegungsstörungen und Charakterveränderungen durch. Als Ursache der Anästhesien und Amnesien fand er eine gewisse „Zerstreutheit“, die ihrem Wesen nach eine „Einengung des Bewußtseinsfeldes“ sei. Die Abulien würden das eigenständige freie Handeln und Denken blockieren und somit das Hereinstürmen automatisierter und triebhafter Vorgänge begünstigen. Dies wiederum führe zu einem Verlust der Ich-Souveränität.
Durch seine Forschungsergebnisse und seine oben beschriebene Kritik an der Charcotschen Methodik trug Janet zu einer Verlagerung der neurologischen zu einer eher psychologischen Hysterietheorie bei.
Wichtig bleibt festzuhalten, daß auch Janet letztlich an der Hereditätslehre Charcots festhält. Anders als dieser hält er jedoch nicht die Suggestibilität für das Wesentliche der hysterischen Erkrankung, sondern ein Defizit an mentaler Energie, wodurch die mentalen Prozesse und Funktionen nicht mehr gut koordiniert werden könnten. Die Folge sei eine Dissoziation mentaler Prozesse, eine Spaltung des Bewußtseins. Durch diese Auffassungen im Zusammenhang mit der durch Janet entwickelte psychologische Analyse wurde der Schwerpunkt der Neurosentheorie von der neurologischen auf eine psychologische Sichtweise gelenkt und einer neuen dynamischen Tiefenpsychologie der Weg geebnet.
Sigmund Freud und die Entwicklung der Psychoanalyse
Über die Person Sigmund Freuds (1856-1939) soll im Rahmen dieses Referates nicht eingegangen werden. Ich möchte hierzu verweisen auf die umfangreiche Biographie von Jones .
Im Jahre 1885 hatte Freud die Gelegenheit bei einem mehrmonatigen Aufenthalt an der Salpétrière Charcot und seine Hysteriestudien ausgiebig kennenzulernen. Durch seine Freundschaft mit Josef Breuer seit 1880 und dessen Berichte über die hypnotische Behandlung seiner Patientin Anna O. 1880-82 hatte Freud bereits erste Bekanntschaft mit der Hysterie gemacht.
Seine weitere Beschäftigung mit hysterischen Phänomenen in Abgrenzung gegen die Lehren Charcots und Janets und unter Einbeziehung der Hypnosetheorie Bernheims führte über einen längeren Prozeß der Hypothesenbildung in den Jahren 1893-1917 zu einer differenzierten Theorie über die Hysterie. Einen Hauptgipfel erreichte sie in den „Studien über Hysterie“ (1895). (Im gleichen Zuge entwickelte er anhand seiner Entdeckungen die Psychoanalyse und mit ihr nahezu alle wichtigen Grundbegriffe der Behandlungstechnik. Dabei entstand die Psychoanalyse zwar nicht im „luftleeren Raum“, da Freud neben den Erkenntnissen Charcots und Janets auf das Gedankengut Fechners und Herbarts sowie auf sein eigenes neuroanatomisches Verständnis zurückgreifen konnte. Die aktuelle psychologische Literatur kannte er jedoch merkwürdigerweise nicht und machte auch keine Anstalten, sie kennenzulernen. Durch seine neuroanatomische Vorbildung und Prägung sind seine Ausführungen zeitlebens stark mechanistisch geblieben, seelische Vorgänge werden als Quantitäten beschrieben, die Abläufe erinnern an Maschinen.
Im Nachruf an Charcot 1893 würdigte Freud zwar ausgiebig die Leistungen seines Lehrers, jedoch kritisierte er auch dessen Hereditätskonzept und bekannte sich zu Bernheims Auffassungen über die Hypnose
Auch gegen Janets Auffassung, daß das Charakteristische der Hysterie in der Bewußtseinsspaltung, der Dissoziation, liege grenzte sich Freud in „Die Abwehr-Neuropsychosen“ frühzeitig ab . Seiner Meinung nach ist das Entscheidende bei der Hysterie die Fähigkeit zur Konversion, der Umsetzung psychischer Energie ins Körperliche. Eine dezidierte Abgrenzung unternimmt er später in seiner Arbeit „Über Grundprinzipien und Absichten der Psychoanalyse (s.a. unter Kapitel „Dissoziation“)
In Freuds erster Publikation mit Deutungsversuch über eine in Hypnose erfolgreich behandelte Hysterica (1892), die nach ihrer ersten Entbindung durch Appetitmangel, Schlaflosigkeit, Versiegen der Milchsekretion und leichte Erregbarkeit am Stillen ihres Kindes gehindert war, sind schon einige Elemente der späteren Psychoanalyse enthalten:
„1. Affekt und Vorstellung werden unterschieden. Sie können voneinander getrennt oder aneinander geknüpft werden…
2. Vorstellung und peinliche Kontrastvorstellung: Das spätere Unbewußte Freuds existiert hier nur als Kontrastvorstellung und Gegenwille. Die Bedeutung der Ambivalenz, der Zwiespältigkeit, die in der späteren Entwicklung der Psychoanalyse von großem Einfluß sein wird, ist hier vorweggenommen.
3. Die „subjektive Unsicherheit“ wird mit dem neurasthenischen Zustand, der nervösen Disposition in Verbindung gebracht; sie erleichtert das Zustandekommen der Gegenvorstellung.
4. Der Gesunde „unterdrückt“ oder „hemmt“ die Kontrastvorstellung. (Später Verdrängung und Abwehr)“ (S.6f)
Die „Kathartische Methode“
Breuer, den Freud von seiner Assistenzzeit bei Brücke her kannte arbeitete damals schon mit einem Verfahren, daß die Patienten in Hypnose versetzte und sie dann aussprechen ließ, was sie bedrückte oder ängstigte. Die in Hypnose durchgeführten Aussprachen, an die sich die Patienten in erwachtem Zustande nicht mehr erinnern konnten, führten tatsächlich zum Rückgang der Symptome. Hysterische Lähmungen, Kontrakturen und die typischen verwirrten Bewußtseinseinschränkungen konnten so zum Verschwinden gebracht werden. Breuer nannte dieses modifizierte hypnotische Verfahren, wo die Erinnerungen an unterdrückte Vorstellungen und das mit dem entsprechenden Gefühl verbundene Aussprechen den Schwerpunkt bildete, das „kathartische Verfahren“.
In den folgenden Jahren bediente sich Freud des „kathartischen Verfahrens“ nach Breuer und stand ohnehin in engem Austausch mit diesem. Gemeinsam veröffentlichten sie 1893 als Ergebnis der Untersuchungen die „Vorläufige Mitteilung über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene“ . Diese beinhalten im wesentlichen folgende Auffassungen:
1. Die von Charcot gemachte Unterscheidung zwischen „idiopathischer“ (degenerativer) und „traumatischer“ Hysterie sei hinfällig. Auch bei der idiopathischen Hysterie sei ein „Trauma“ festzustellen, allerdings ein „psychisches Trauma“, wie Angst, Schreck oder Scham, welches in Zusammenhang mit den hysterischen Symptomen stehe.
2. Die zwischen Veranlassung und dem pathologischen Phänomen bestehende Beziehung kann direkter oder symbolischer Natur sein.
3. Ob das Erlebnis als Trauma zur Geltung kommt, hinge auch von der Reizbarkeit oder Empfindlichkeit ab, die bei dem Betreffenden zum Zeitpunkt des Traumas bestehe.
4. Auch sich summierende „Partialtraumen“ oder „gruppierte Anlässe“ können anstelle eines einzigen großen Traumas pathogen wirken.
5. Nicht das Trauma bringt die Symptome hervor, sondern die Erinnerung an dasselbe.
6. „Affektloses Erinnern ist fast immer völlig wirkungslos; der psychsche Prozeß, der ursprünglich abgelaufen war, muß so lebhaft als möglich wiederholt, in statum nascendi gebracht und dann „ausgesprochen“ werden. Dabei treten, wenn es sich um Reizerscheinungen handelt, diese: Krämpfe, Neuralgien, Halluzinationen – noch einmal in voller Intensität auf und verschwinden dann für immer. Funktionsausfälle, Lähmungen und Anästhesien schwinden ebenso, natürlich ohne daß ihre momentane Steigerung deutlich wäre.“ (S. 30)
7. „…dürfen wir wohl schließen, der veranlassende Vorgang wirke in irgendeiner Weise noch nach Jahren fort, nicht indirekt durch Vermittlung einer Kette von kausalen Zwischengliedern, sondern unmittelbar als auslösende Ursache, wie etwa ein im wachen Bewußtsein erinnerter psychischer Schmerz noch in späterer Zeit die Tränensekretion hervorruft: der Hysterische leide größtenteils an Reminiszenzen. (S. 31)
8. Es gibt im Gesunden mehrere Möglichkeiten bei einer „Kränkung“ die Entwicklung hysterischer Symptome zu vermeiden:
a. Das adäquate „Abreagieren“ mit nachfolgender vollständiger „kathartischer“ Wirkung
b. Die Korrektur durch andere Assoziationen: „Die Erinnerung daran (Anm.: an das Trauma) tritt, auch wenn sie nicht abreagiert wurde, in den großen Komplex der Assoziationen ein, sie rangiert dann neben anderen, vielleicht ihr widersprechenden Erlebnissen, erleidet eine Korrektur durch andere Vorstellungen. Nach einem Unfall z.B. gesellt sich zu der Erinnerung an die Gefahr und zu der (abgeschwächten) Wiederholung des Schreckens die Erinnerung des weiteren Verlaufes, der Rettung, das Bewußtsein der jetzigen Sicherheit. Die Erinnerung an eine Kränkung wird korrigiert durch Richtigstellung der Tatsachen, durch Erwägungen der eigenen Würde u. dgl., und so gelingt es dem normalen Menschen, durch Leistungen der Assoziation den begleitenden Affekt zum Verschwinden zu bringen.“ (S. 33)
Bezüglich der hysterisch Kranken gilt jedoch:
„…, daß die pathogen gewordenen Vorstellungen sich darum so frisch und affektkräftig erhalten, weil ihnen die normale Usur durch Abreagieren und durch Reproduktion in Zuständen ungebremster Assoziation versagt ist.“ (S. 35)
c. Das Verblassen der Erinnerungen, das „Vergessen“, welches „vor allem die affektiv nicht mehr wirksamen Vorstellungen usuriert.“ (S. 33)
9. Einteilung der psychischen Traumata in zwei Gruppen:
a. Traumata, die eine adäquate Reaktion aus verschiedenen Gründen nicht erlauben oder ermöglichen, z. B. „beim unersetzlich erscheinenden Verlust einer geliebten Person, oder weil die sozialen Verhältnisse eine Reaktion unmöglich machten, oder weil es sich um Dinge handelte, die der Kranke vergessen wollte, die er darum absichtlich aus seinem bewußten Denken verdrängte, hemmte und unterdrückte.“ (S. 34)
b. Traumata, die „nicht durch den Inhalt der Erinnerungen, sondern durch die psychischen Zustände bestimmt (werden), mit welchen die entsprechenden Erlebnisse beim Kranken zusammengetroffen haben.“ (S. 34) Als Beispiele nennt er Entstehung durch Schreck oder „direkt in abnormen psychischen Zuständen, wie im halbhypnotischen Dämmerzustande des Wachträumens, in Autohypnose und dgl..“ (S. 34)
10. Bestätigung der von Janet und Binet festgestellten Neigung zur „Dissoziation“ mit „Spaltung des Bewußtseins“ und der Ausbildung „hypnoider Zustände“ für jede Hysterie
11. „Hypnoide Zustände“ als „Grundlage und Bedingung der Hysterie“ (S. 36).
Unterscheidung zwischen „disponierter“ und „akquirierter“ Hysterie:
„Bestehen solche hypnoiden Zustände schon vor der manifesten Erkrankung, so geben sie den Boden ab, auf welchem der Affekt die pathogene Erinnerung mit ihren somatischen Folgeerscheinungen ansiedelt. Dies Verhalten entspricht der disponierten Hysterie. Es ergibt sich aber aus unseren Beobachtungen, daß ein schweres Trauma (wie das der traumatischen Neurose), eine mühevolle Unterdrückung (etwa des Sexualaffektes) auch bei dem sonst freien Menschen eine Abspaltung von Vorstellungsgruppen bewerkstelligen kann, und dies wäre der Mechanismus der psychisch akquirierten Hysterie.“ (S. 36)
Die „disponierenden hypnoiden Zustände“ entwickeln sich nach Freud oft aus den bei Gesunden häufigen „Tagträumen“, z.B. bei weiblichen Handarbeiten.
12. Freud ist der Auffassung, „daß man unter den Hysterischen die geistig klarsten, willensstärksten, charaktervollsten und kritischsten Menschen finden kann.“ (S. 37)
13. Freud würdigt Charcots Experimente mit posttraumatischen Lähmungen als Beitrag zum Verständnis des „Mechanismus hysterischer Symptome“. Die Ätiologie der Hysterie sei dadurch jedoch „nur gestreift“ worden (S. 41)
14. Beurteilung der psychotherapeutischen Efizienz: dauerhaftes Verschwinden von Symptomen durch die „kathartische Methode“ sei möglich, allerdings sei dies keine Heilung der Hysterie, da die Symptome selbstverständlich an jeder beliebigen Stelle wiederauftreten könnten. (S. 41)
Die Arbeit über die „Abwehr-Neuropsychosen“ (1894)
1894 veröffentlichte Freud seine Arbeit über die „Abwehr-Neuropsychosen“. In dieser Abhandlung dehnte er seine Erkenntnisse auf den Bereich der Angst- und Zwangsneurosen aus. Es wird erstmals von „Abwehr“ (der Vorläufer der späteren „Verdrängung“, häufig synonym benutzt) gesprochen und der Begriff der „Konversion“ wird eingeführt und als eine spezielle Art der Abwehr verstanden. Ebenso werden andere Formen der Abwehr angeführt und gegen die konversionsneurotische Form abgegrenzt. Freud unterscheidet nun in Anlehnung an die „Vorläufigen Mitteilungen“ von 1893 zwischen „Abwehrhysterie“ und Hypnoidhysterie.
Bei der Abwehrhysterie wird eine unverträgliche, peinliche Vorstellung, die bei weiblichen Personen oft mit deren „sexualem Erleben“ zusammenhängt vom Ich abgewehrt und führt zu körperlichen Symptomen über den Modus der Konversion.
Definition der „Konversion“:
„Bei der Hysterie erfolgt die Unschädlichmachung der unverträglichen Vorstellung dadurch, daß deren Erregungssumme ins Körperliche umgesetzt wird, wofür ich den Namen der Konversion“ vorschlagen möchte.“
Entsprechend der o.g. Hypothese über die Trennung von Vorstellung und Affekt wird bei nicht zur Konversion neigenden Menschen der von der Vorstellung abgespaltene Affekt auf psychischem Gebiet verbleiben. Dann entstehen die Zwangsneurosen (Anhängung an nicht unbedingt unverträgliche Vorstellungen) und Phobien.
Die o.g. Arbeit brachte nach Wyss folgende wichtige Erweiterungen für die Fortentwicklung der Psychoanalyse:
1. Das Symptom entsteht aus dem Kräftespiel zwischen dem eine unangenehme Vorstellung abwehrenden Ich einerseits und der abgewehrten Vorstellung und dem Affekt andererseits. Der Affekt kann entweder in das Körperliche abgeführt werden, es entsteht die Konversion, oder er wird von seiner Vorstellung abgespalten und mit einer anderen Vorstellung verknüpft: es entsteht die Zwangsneurose oder Phobie.
2. Die abgewehrten peinlichen Vorstellungen entstammen meistens dem Sexualleben.
3. Die bei der Hysterie entdeckten Mechanismen ließen sich auch zur Erklärung anderer Störungen des Seelenlebens verwenden. Damit war der Schritt von einer Psychotherapie der Hysterie hin zu der der Neurosen und zur allgemeinen Psychotherapie vollzogen.
In das Jahr 1894 fällt auch die Entdeckung der Affektverwandlung und die Zuordnung zu bestimmten Krankheitsbildern:
so unterscheidet Freud:
1. Affektverwandlung (Konversions-Hysterie)
2. Affektverschiebung (Zwangsvorstellungen und Phobien)
3. Affektvertauschung (Angstneurose und Melancholie)
Die „Studien über Hysterie“ (1895)
1895 erscheinen die von Freud und Breuer gemeinsam herausgegebenen „Studien über Hysterie“ und brachte neben der Fallstudie der Anna O. und vier eigenen Fällen Freuds ein Kapitel „Theoretisches“ von Breuer und das Kapitel „Zur Psychotherapie der Hysterie“ von Freud. Die „Studien“ stellen das Kernstück Freudscher Theoriebildung über hysterische Phänomene dar, in sie münden die in den vorherigen Jahren gemachten Entdeckungen ein. Darüberhinaus werden viele die Psychoanalyse konstituierende Begriffe vorgestellt. Es entsteht eine erste Topik des Unbewußten. Die „Studien“ leiten den Übergang von der „kathartischen Methode“ Breuers zur Psychoanalyse ein. Diese Neuerungen sollen nun kurz aufgezeigt werden:
1. Von der „kathartischen Methode“ über die Methode des „Drängens“ (Druckausübung) zur „freien Assoziation“:
Drei Gründe bewogen Freud das „kathartische“ Verfahren zu modifizieren.
Erstens erschien die Methode nicht kausal wirksam zu sein, sondern heilte nur symotomatisch, d.h. es bestand eine Neigung des verschwundenen Symptoms, an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Außerdem gelang es keineswegs allen Patienten, den Affekt in gewünschter Weise abzureagieren.
Zweitens: Wie sollte man die (vielen!) Patienten behandeln, die sich nicht in Hypnose versetzen ließen?
Drittens: Freud entdeckte durch seine Behandlungen die Bedeutung des Widerstandes und der Übertragung Aus diesen Behandlungsschwierigkeiten entwickelte sich später die Psychologie der Übertragung, ein Kernstück der psychoanalytischen Behandlungstechnik
2. Der entdeckte Widerstand auf seiten des Patienten im Verlauf der Behandlung, daß er sich z.B. hartnäckig weigerte, eine bestimmte Begebenheit etwa sexueller Natur zu erinnern, ist „identisch“ mit der „Kraft der Abwehr“ oder Verdrängung, die das Auftauchen einer Erinnerung verhinderte.
3. Der Widerstand scheint Folge einer „Zensur“ zu sein, die das Ich ausübt, damit unverträgliche Erinnerungen nicht ins Bewußtsein gelangen.
4. Durch den Übergang zur „freien Assoziation“ gelang es Freud, das „Unbewußte“ neu zu beschreiben und eine erste topische Anordnung zu formulieren:
Nach dieser ersten Vorstellung ist das pathogene Material der Hysterischen im Unbewußten in mindestens drei „Schichten“ um einen pathogenen „Kern“ herum organisiert:
„Es ist zunächst ein Kern vorhanden von solchen Erinnerungen (an Erlebnisse oder Gedankengänge), in denen das traumatische Moment gegipfelt oder die pathogene Idee ihre reinste Ausbildung gefunden hat. Um diesen Kern herum findet man oft unglaublich reichliche Menge von anderem Erinnerungsmaterial, die man bei der Analyse durcharbeiten muß, in, wie erwähnt, dreifacher Anordnung. Erstens ist eine lineare chronologische Anordnung unverkennbar, die innerhalb jedes einzelnen Themas statthat. Alas Beispiel für diese zitiere ich bloß die Anordnungen in Breuers Analyse der Anna O. Das Thema sei das des Taubwerdens, des Nichthörens (S. 56f.); das differenzierte sich dann nach 7 Bedingungen, und unter jeder Überschrift waren 10 bis über 100 Einzelerinnerungen in chronologischer Reihenfolge gesammelt. Es war, als ob man ein wohl in Ordnung gehaltenes Archiv ausnehmen würde. In der Analyse meiner Patientin Emmy v. N….sind ähnliche, wenn auch nicht so vollzählig dargestellte Erinnerungsfaszikel enthalten: sie bilden aber ein ganz allgemeines Vorkommnis in jeder Analyse, treten jedesmal in einer chronologischen Ordnung auf, die so unfehlbar verläßlich ist wie die Reihenfolge der Wochentage oder Monatsnamen beim geistig normalen Menschen, und erschweren die Arbeit der Analyse durch die Eigentümlichkeit, daß sie die Reihenfolge ihrer Entstehung bei der Reproduktion umkehren; das frischeste, jüngste Erlebnis des Faszikels kommt als „Deckblatt“ zuerst, und den Schluß macht jener Eindruck, mit dem in Wirklichkeit die Reihe anfing.
Ich habe die Gruppierung gleichartiger Erinnerungen zu einer linear geschichteten Mehrheit, wie es ein Aktenbündel, ein Paket u. dgl. darstellt, als Bildung eines Themas bezeichnet. Diese Themen nun zeigen eine zweite Art von Anordnung; sie sind…konzentrisch um den pathogenen Kern geschichtet. Es ist nicht schwer zu sagen, was diese Schichtung ausmacht, nach welcher ab- oder zunehmenden Größe diese Anordnung erfolgt. Es sind Schichten gleichen, gegen den Kern hin wachsenden Widerstandes und damit Zonen gleicher Bewußtseinsveränderung, in denen sich die einzelnen Themen erstrecken. Die periphersten Schichten enthalten von verschiedenen Themen jene Erinnerungen (oder Faszikel), die leicht erinnert werden und immer klar bewußt waren; je tiefer man geht, desto schwieriger werden die auftauchenden Erinnerungen erkannt, bis man nahe am Kerne auf solche stößt, die der Patient noch bei der Reproduktion verleugnet….
Jetzt ist noch eine dritte Art von Anordnung zu erwähnen, die wesentlichste, über die am wenigsten leicht eine allgemeine Aussage zu machen ist. Es ist die Anordnung nach dem Gedankeninhalte, die Verknüpfung durch den bis zum Kerne reichenden logischen Faden, der einem in jedem Falle besonderen, unregelmäßigen und vielfach abgeknickten Weg entsprechen mag. Diese Anordnung hat einen dynamischen Charakter, im Gegensatze zum morphologischen der beiden vorerst erwähnten Schichtungen. Während letztere in einem räumlich ausgeführten Schema durch starre, bogenförmige und gerade Linien darzustellen wären, müßte man dem Gange der logischen Verkettung mit einem Stäbchen nachfahren, welches auf den verschlungensten Wegen aus oberflächlichen in tiefe Schichten und zurück, doch im allgemeinen von der Peripherie her zum zentralen Kerne vordringt und dabei alle Stationen berühren muß, also ähnlich wie das Zickzack der Lösung einer Rösselsprungaufgabe über die Felderzeichnung hinweggeht.“
5. Das einzelne Symptom ist häufig „mehrfach determiniert, überbestimmt“
Dazu Freud in Ergänzung des oben Gesagten:
„Der logische Zusammenhang entspricht nicht nur einer zickzackförmig geknickten Linie, sondern vielmehr einer verzweigten, und ganz besonders einem konvergierenden Liniensysteme. Er hat Knotenpunkte, in denen zwei oder mehrere Fäden zusammentreffen, um von da an vereinigt weiterzuziehen, und in den Kern münden in der Regel mehrere unabhängig voneinander verlaufende oder durch Seitenwege stellenweise verbundene Fäden ein. Es ist sehr bemerkenswert, um es mit anderen Worten zu sagen, wie häufig ein Symptom mehrfach determiniert, überbestimmt ist.“
Die „Abwehr-Neuropsychosen“ (korrigierte Version von 1896)
In der 1896 publizierten Arbeit über „Abwehr-Neuropsychosen“, die mit der Analyse einer chronischen Paranoia abgeschlossen wird kommt es gegenüber der gleichlautenden Abhandlung von 1894 zu folgenden neuen Erkenntnissen (nach Wyss) :
1. Die Bedeutung der Sexualität für die Ätiologie der Hysterie und Neurosen wird dahingehend erweitert, daß nicht nur aktuelle sexuele Traumen pathogenetisch wirksam sind, sondern bereits in früher Kindheit erlebte. Diese werden zur Zeit der sexuelen Reife wiedererinnert, die Wiedererinnerung, nicht das Trauma, wirkt krankheitsauslösend.
2. Die Symptome der Zwangsneurose sind Kompromißbildungen z.b. zwischen verdrängtem Vorwurf und verdrängendem Ich. Der Kompromißcharakter der Symptome wird spontan auf alle psychoneurotischen Symptome, einschließlich des Traumes, ausgedehnt.
3. Die Verdrängung erweist sich ebenfalls als ein zeitlich und dynamisch gegliederter Vorgang, der bei der Zwangsneurose in drei Phasen unterteilt werden kann
4. Affekte und mit ihnen verknüpfte Vorstellungen können sich verwandeln. (z.B. Sexualität in Vorwurf). der Affekt wird als Erregungssumme definiert, damit ist sein rein quantitativer Charakter bestimmt, dem einer Verwandlung in beliebig andere „Energieformen“ nichts im Wege steht.
5. Charakterzüge wie Gewissenhaftigkeit, Mißtrauen, Scham werden erstmalig als Reaktionsbildungen im Sinne der Abwehr peinlicher Vorstellungen aufgefaßt.
6. Der Begriff der „Projektion“ wird zum erstenmal eingeführt.
Die Traumdeutung (1900)
Die folgenden Jahre Freuds waren zunehmend der Beschäftigung mit dem Traum (hierin auch Entwicklung des ersten definitiven topischen Modells des Unbewußten ), der Selbstanalyse sowie der Beschäftigung mit der Sexualität und der Ausarbeitung einer neuen psychosexuellen Entwicklungstheorie auf der Grundlage der Libidotheorie gewidmet. Die in diesem Rahmen entstehenden Werke der „Traumdeutung“ (1900) und der „Drei Abhandlungen zur Sexualtherapie“ (1905) stellen mit die wichtigsten Arbeiten seines Gesamtwerkes dar. Wichtige Tabus, z.B. das der kindlichen Sexualität, der Aufgang der Sexualität in dem allumfassenden Begriff der Libido, die Entdeckung des Wunschcharakters der Träume und die Übertragung auf das psychoneurotische Symptom und nicht zuletzt die folgenreiche Ersetzung des Ich durch den Trieb sind mit dieser Entwicklung verbunden. Auf diese Entwicklung kann im Rahmen dieses Referates nicht im einzelnen eingegangen werden, lediglich für das Verständnis der Freudschen Hysterietheorie relevante Aspekte werden herausgegriffen:
Bei den Arbeiten mit Träumen stieß Freud auf die große Ähnlichkeit zwischen dem Trauminhalt und dem hysterischen Symptom. Er erkannte daraufhin den „Wunschcharakter“ des Symptoms und er begann im Aufbau des Traumes den Schlüssel zum Verständnis der Hysterie zu sehen. Gleichzeitig entdeckt er auch den Selbstbestrafungscharakter des Symptoms (und später auch bestimmter Träume).
Bei der Selbstanalyse entdeckte Freud den „Ödipuskomplex“ an sich selber. Leider fehlt jedoch eine systematische Darstellung, obwohl dieser Konflikt nach Auffassung Freuds und noch lange nach ihm die entscheidende Bedeutung bei der hysterischen Neurose, aber auch bei allen anderen Neurosen spielte. Die erste Erwähnung durch Freud erfolgte 1910 in seinem Aufsatz „Über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Mann“. Er unterschied einen positiven und einen negativen Ödipuskomplex:
1. positiver Ö.: „Todeswunsch gegenüber dem Rivalen als Person gleichen Geschlechts und sexueller Wunsch gegenüber der Person des entgegengesetzten Geschlechts. In seiner negativen Form stellt er sich wie folgt dar: Liebe für den gleichgeschlechtlichen Elternteil und eifersüchtiger Haß für den gegengeschlechtlichen. In Wirklichkeit finden sich beide Formen in unterschiedlichem Grade in dem sogenannten vollständigen Ödipuskomplex.
Nach Freud wird der Ödipuskomplex zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr auf seinem Höhepunkt erlebt, zur Zeit der phallischen Phase; sein Untergang kennzeichnet den Eintritt in die Latenzperiode. In der Pubertät erfährt er eine Wiederbelebung und wird mit mehr oder weniger Erfolg durch einen besonderen Typus der Objektwahl überwunden.“
1916/17 in seinen „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ hat Freud prägnant formuliert, daß für die hysterische Neurose der ungelöste Ödipuskomplex den pathogenen Zentralkonflikt darstellt.
Die Entwicklung seiner Sexualpathologie gipfelt in den „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ (1905). Für die Hysterie ist die Einteilung in „Entwicklungsphasen“ wichtig. Dabei definiert er zunächst nur die „prägenitalen“ Phasen der „oralen“ und der „sadistisch-analen Organisation“. Erst später schaltete er nach diesen prägenitalen Phasen eine weitere, die „genitale“ oder „phallische“ Phase in die Kindheitsentwicklung ein.
Die Vorstellung, daß hysterische Phänomene mit dem ungelösten Ödipuskomplex und somit mit der phallischen (genitalen) Phase untrennbar verknüpft seien, blieb lange Zeit ein psychoanalytisches Gesetz und wurde erst durch Marmor (s.u.) gelockert.
Die Arbeit, die gewissermaßen eine Brücke schlägt zwischen den Erkenntnissen der Traumdeutung und denen der „Drei Abhandlungen“ ist das Werk „Bruchstücke einer Hysterie-Analyse“ (1905). Im Mittelpunktder Analyse stehen zwei Träume, auf die Freud seine Deutungskunst virtuos anwendet; andererseits entwickelt er Hypothesen über das sexuell-organische Fundament der Erkrankung, über erogene Körperzonen und das Phänomen der Bisexualität. Bruchstücke deshalb, weil die Patientin „Dora“ die Analyse vorzeitig abbrach. Nach Freuds Meinung deswegen, weil er die Übertragung nicht ausreichend beachtet habe; durch diese Erkenntnis gelingt ihm eine weitere Präzisierung dieses Kernbegriffs, der heute noch im Zentrum jeder psychoanalytischen Psychotherape steht.
Literatur
Alarcon, R. D. (1973)
„Hysteria and Hysterical Personality: How come one without the other?“
Psychiat. Quart., 47, 258 – 275
Briquet, P. (1859)
„Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie“
Paris (Baillière
Bruttin, Jean-Marie (1969)
„Différentes théories sur l’hystérie dans la première moitié du XIXe
siècle“, Diss. Zürich 1969
Chodoff, P., Lyons, H. (1958)
„Hysteria, the hysterical personality and hysterical conversion.“
Am. J. Psychiat. 114, 734 – 740
Easser, B. R., Lesser, S. R. (1965)
„Hysterical Personality: A Re-Evaluation“
Psa. Quart. 34, 390 – 405
Eckart, W. U./Gradmann, Ch. (1995)
„Ärztelexikon – Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“
Eckhart, W. (Hrsg.)
München, Beck’sche Reihe (1995)
Eckhardt, Annegret (1996)
„Die Dissoziation – Klinische Phänomenologie, Ätiologie und Psychodynamik“
in: Hysterie heute, Enke-Verlag, 1996, Hrsg.: Seidler, Günter H.
Ellenberger, H. F. (1970)
„Die Entdeckung des Unbewußten“
Orig.: „The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of
Dynamic Psychiatry“
Basic Books, New York (1970), Diogenes TB, 2. Aufl. 1996
Fischer-Homberger, Esther (1970)
„Hypochondrie, Melancholie bis Neurose: Krankheiten und
Zustandsbilder“
Verlag Huber, Bern (1970)
Fischer-Homberger, Esther (1975)
„Die traumatische Neurose – Vom somatischen zum sozialen Leiden“
Verlag Hans Huber, Bern (1975)
Freud, A. (1936)
„Das Ich und die Abwehrmechanismen“
Geist und Psyche, Fischer Taschenbuch Verlag 1996
Freud, Sigmund (1888/89)
Vorrede des Übersetzers zu H. Bernheim: Die Suggestion und ihre
Heilwirkung,
GW Nachtragsbd., S. 107-120
Freud, Sigmund (1892/23)
„Ein Fall von hypnotischer Heilung“
GW I
Freud, Sigmund (1893)
„Charcot“
GW I, 21-35
Freud, Sigmund (1893)
„Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene“
in: Breuer/Freud, „Studien über Hysterie“ (1895), Fischer, Psychologie
Freud, Sigmund (1894)
„Die Abwehr-Neuropsychosen“
GW I, S. 57-74
Freud, Sigmund/Breuer, Josef (1895)
„Studien über Hysterie“
Fischer TB-Verlag, 1991, Frankfurt am Main
Freud, Sigmund (1896)
„Zur Ätiologie der Hysterie“
Sigmund Freud, Studienausgabe, Bd. VI (Hysterie und Angst), S. Fischer-Verlag,
S. 51-81
Freud, Sigmund (1900)
„Die Traumdeutung“
Psychologie, Fischer-Verlag
Freud, Sigmund (1905)
„Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“
Psychologie, Fischer-Verlag
Freud, Sigmund (1905)
„Bruchstück einer Hysterie-Analyse“
Fischer TB (Psychologie), 1993
Freud, Sigmund (1908)
„Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualität“
Studienausgabe, Bd. VI, Fischer-Verlag, S. 188-195
Freud, Sigmund (1908)
„Charakter und Analerotik“
in: Schriften zur Krankheitslehre der Psychoanalyse
Psychologie, Fischer-Verlag, 131-138
Freud, Sigmund (1909)
„Allgemeines über den hysterischen Anfall“
Studienausgabe, Bd. VI, Fischer-Verlag, S. 198-203
Freud, Sigmund (1911/13)
„Grundprinzipien und Ansichten der Psychoanalyse“
GW, S. 724f
Freud, Sigmund (1916/17)
„Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“
GW, Bd. XI
Freud, Sigmund (1923)
„Die infantile Genitalorganisation“
Intern. Zeitschr. f. Psychoanalyse, IX, 1923
Freud, Sigmund (1926)
„Hemmung, Symptom und Angst“
GW XIV
Gilles de la Tourette (1891-95)
„Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie d’après l’enseignement de
la Salpêtrière“, 3 Bde., Paris, (Plon et Nourrit)
übers. von K. Grube: Die Hysterie nach den Lehren der Salpétrière
(1894), Leipzig-Wien (Deuticke)
Gödde, G. (1994)
„Charcots neurologische Hysterietheorie – Vom Aufstieg und Niedergang
eines wissenschaftlichen Paradigmas.“
in: Luzifer-Amor, Zschr. zur Geschichte der Psychoanalyse,
7. Jahrgang, Heft 14 (1994)
Green, B. A. (1974)
Vortrag auf dem „Panel on Hysteria today“
Rep.: J. Laplanche. Int. J. Psa., 55, 464 – 466
Heigl-Evers, A. (1967)
„Zur Frage der hysterischen Abwehrmechanismen“
Z. Psychosomat. Med. Psa. 13, 116 – 130
Hoffmann, S. O. (1979)
„Charakter und Neurose. Ansätze zu einer psychoanalytischen
Charakterologie.“
Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2. Auflage 1996
Israël, Lucien (1979)
„Die unerhörte Botschaft der Hysterie“
München, Basel (Reinhardt), 3. Aufl.
Janet, Pierre (1893)
„Contribution à l’étude des accidents mentaux chez les hystériques.“
Paris, Rueff & Cie.
Janet, Pierre (1895)
„J. M. Charcot, son oeuvre psychologique.“
Revue Philosophique, Bd. 39
Janet, Pierre (1898)
„Névroses et idées fixes“
Paris, Alcan, 2 Bde
Janet, Pierre (1903)
„Les Obsessions et la psychasthénie“
Paris, Alcan, 2 Bde.
Jones, E. (1960/62)
„Das Leben und Werk von Sigmund Freud“
Bd. I 1960, Bd. II 1962, Huber, Bern/Stuttgart
Kraepelin, Emil (1889)
„Psychiatrie“
Leipzig (1889), 3. Aufl.
Laplanche, J./Pontalis, J.-B. (1973)
„Das Vokabular der Psychoanalyse“
Suhrkamp, 11. Aufl. (1992), Frankfurt am Main
Lazare, A. (1971)
„Hysterical character in psychoanalytic theory“
Archs. Gen. Psychiat. 25, 131 – 137
Lazare, A., Klerman, G. L. (1968)
„Hysteria and Depression: The Frequency and Significance of Hysterical Personality
Features in Hospitalized Depressed Women.“
Am J. Psychiat. 124, 48 – 56
Lindberg, B. J., Lindegard, B. (1963)
„Studies of the Hysteroid Personality Attitude.“
Acta Psychiat. Scand., 39, 170 – 180
Lorenzer, A. (1984)
„Intimität und soziales Leid. Archäologie der Psychoanalyse.“
Frankfurt/Main (Fischer)
Marmor, J. (1953)
„Orality in the hysterical personality.“
J. Am. Psa. Ass. I, 656 – 671
Mentzos, S. (1971)
„Die Veränderung der Selbstrepräsentanz in der Hysterie: Eine
spezifische Form der regressiven De-Symbolisierung.“
Psyche, 25, 669 – 684
Mentzos, S. (1973)
„Zur Psychodynamik der sogenannten „hysterischen“ Psychosen“
Nervenarzt 44, 285-291
Mesmer, F. A. (1779)
„Mémoir sur la dècouverte du Magnétisme Animal“
Paris (1779)
Namnum, A. (1974)
Vortrag auf dem „Panel on Hysteria today“
Rep.: J. Laplanche. Int. J. Psa., 55, 460 – 463
Rapaport, D. (1947a)
„Some Reqirements for a Clinical Useful Theory of Memory“
In: M. Gill (Ed.), The Collected Papers of D. Rapaport.
Basic Books, New York/London, 1967, 251 – 260
Reich, W. (1933)
„Charakteranalyse“
1971, 1989 Kiepenheuer & Witsch, Köln
Richet, Paul (1881)
„Etudes cliniques sur l’hystéro-épilesie ou Grande hystérie“
Paris, Delahaye et Lecrosnier
Shapiro, D. (1965)
„Neurotische Stile“
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991
Siegman, A. J. (1954)
„Emotionality – a Hysterical Character Defence“
Psa. Quart., 23, 339 – 354
Valenstein, A. F. (1962)
„The Psycho-Analytic Situation“
Int. J. Psa., 43, 315 – 324
Wittels, F. (1931)
„Der hysterische Charakter“
Psa. Bewegung, 3, 138 – 165
Orig.: „The Hysterical Character“
Med. Review of Reviews, (Psychopath. Number) 36 (1930a), 186 – 190
Wyss, Dieter (1961)
„Die Tiefenpsychologischen Schulen von den Anfängen bis zur
Gegenwart – Entwicklung, Probleme, Krisen“
6. Auflage (1991), Vandenhoeck & Ruprecht
Zetzel, E. (1968)
„The so Called Good Hysteric“
Int. J. Psa., 49, 256 – 260
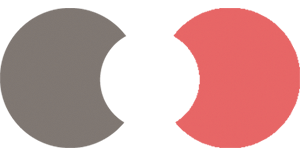
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!